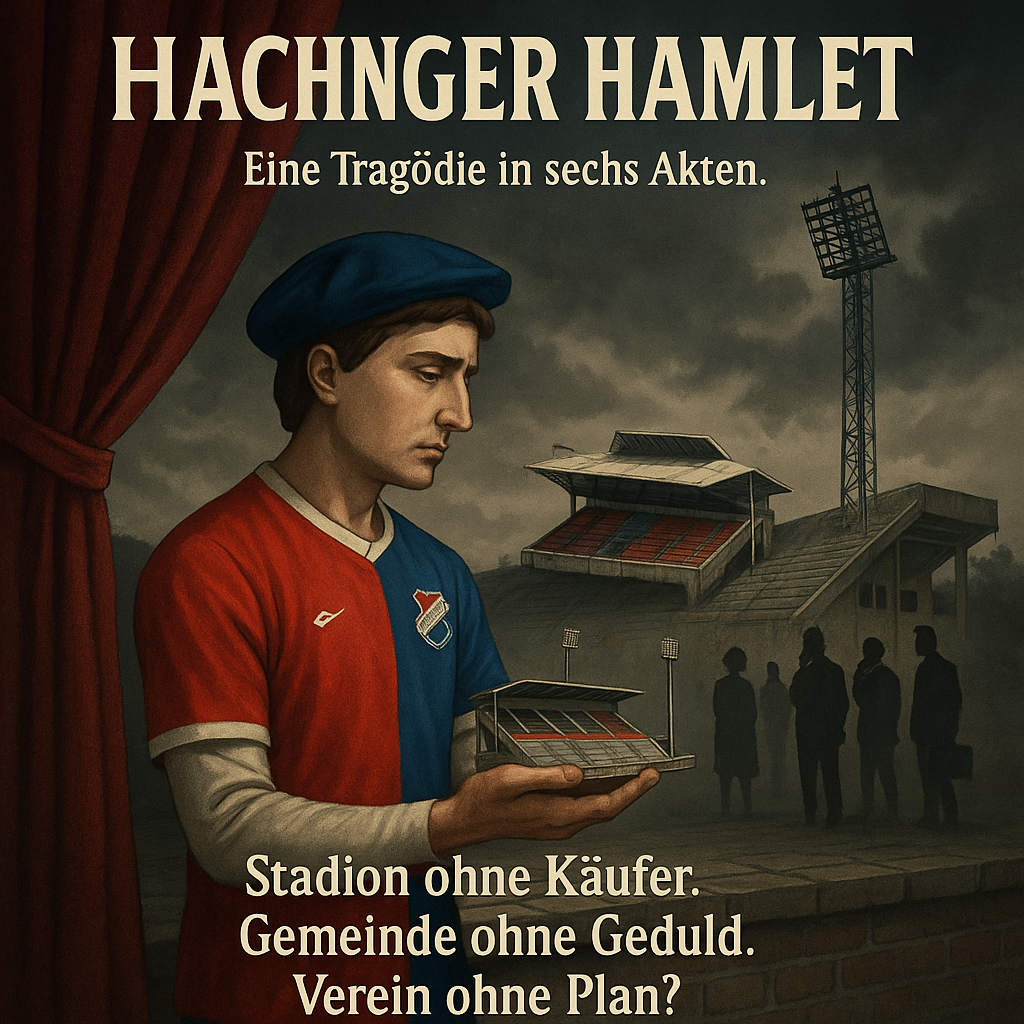Servus mitanand,
seit dem Jahreswechsel wird in Haching gefeiert. Weniger der aktuelle sportliche Lauf, sondern viel mehr der runde 100. Geburtstag der Spielvereinigung. Früher wurden Runden mit dem Bob gedreht, schon immer wird gegen das runde Leder getreten. Runde Bäuche freuen sich über Lokalrunden unseres Präsidenten und rund um die Uhr arbeitet dieser. Für die Rückrunde schwant mir Böses und wir müssen wohl für eine Ehrenrunde in die Regionalliga, immerhin haben wir noch die Chance die erste Pokalrunde zu erreichen. Einfach eine runde Sache.
Um diesem Jubiläum den passenden Rahmen zu geben und in der erfolgreichen Vergangenheit des Vereins zu schwelgen, treffe ich mich hier in unregelmäßigen Abständen mit prägenden Figuren meiner persönlichen Haching Vergangenheit.
„Haching war vor und zu meiner Zeit besonders und ist es jetzt immer noch.“
Interview mit Robert Lechleiter
Den Auftakt macht kein Geringerer als Robert Lechleiter, seines Zeichens Stürmer unter Trainern wie Heribert „Harry“ Deutinger, Werner Lorant oder Ralph Hasenhüttl. Im Jahr 2003 wechselte der damals 23 Jährige in die Vorstadt und stürmte 5 Jahre lang für Rot-Blau. Nach 114 Spielen war Schluss und der Oberbayer wechselte über Rostock nach Aalen. Nach seiner aktiven Karriere war er nochmal als U19 Coach und Co-Trainer in Unterhaching tätig. Heute ist er der U19 Trainer des SSV Ulm. Im Gespräch mit moneyschwabl spricht Lechleiter über seinen Weg zum Fußballprofi, seine Zeit in Unterhaching und vieles mehr.
moneyschwabl: Servus Robert! Als du jung warst, spielten Nachwuchsleistungszentren (NLZs) noch keine große Rolle. Wie unterscheidet sich deiner Meinung nach die heutige Ausbildung junger Spieler von der damaligen Zeit, und wie siehst du den qualitativen Unterschied?
Robert Lechleiter: Der Unterschied ist tatsächlich sehr groß. Heutzutage werden die Jugendlichen in den NLZs viel besser ausgebildet als früher. Allerdings möchte ich anmerken, dass es früher – mein Jahrgang ist da ein gutes Beispiel, und ich habe kürzlich ein passendes Interview von Matthias Zimmermann gelesen – durchaus möglich war, sich über Amateurvereine hochzuarbeiten, bis man es in den Profibereich schaffte.
Ich glaube, dass dieser Weg heute schwieriger geworden ist, da die NLZs die besten Talente aus der Region holen. Diese Jugendlichen trainieren dann vier- bis fünfmal pro Woche und werden besonders im technischen und taktischen Bereich viel intensiver geschult als früher.
Jedoch hatte die frühere „Bolzplatz-Mentalität“ auch ihre Vorteile. Ich selbst hatte zwar nur zweimal pro Woche Training hier in Aßling, war aber zusätzlich noch dreimal wöchentlich auf dem Fußballplatz – und das hat sicherlich nicht geschadet.
moneyschwabl: Zu diesem Thema stelle ich mir oft die Frage: In den NLZs gibt es ja immer noch den Kritikpunkt, dass die älteren Jahrgänge ihren körperlichen Vorteil ausnutzen, bis sich das dann etwa in der U19 ausgleicht. Jüngere Spieler, die vielleicht technisch stärker sind, haben dadurch einen Nachteil, weil sie es schwerer haben, in die NLZs zu kommen. Meine Frage: Hätte der junge Robert Lechleiter damals einen Platz in einem NLZ bekommen?
Robert Lechleiter: Das ist eine interessante Frage, da ich im Juli geboren bin und somit mitten im Jahr stecke. Es ist schwer zu sagen. Ich hatte in meiner Jugendzeit durchaus die Möglichkeit, zu dem einen oder anderen größeren Verein zu wechseln, wollte das aber damals nicht. Mir war es wichtig, mit meinen Freunden hier zu kicken. Dass sich mein Weg dann doch noch so entwickelt hat, war mit Sicherheit harte Arbeit, aber auch ein bisschen Glück. Ich würde sagen, ja, ich hätte wahrscheinlich irgendwie einen Platz ergattern können.
moneyschwabl: Du bist ja dann mit 21 Jahren erst nach Ismaning in die Oberliga gewechselt. War das in dieser Zeit oder kurz davor, als du die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht hast? Hattest du damals noch die Hoffnung, es in den Profifußball zu schaffen, oder war das eher eine ambitionierte Nebensache für dich?
Robert Lechleiter: Da muss ich sogar noch einen Schritt zurückgehen. Als ich mit 18 Jahren von Aßling nach Baldham gewechselt bin, war das der erste Schritt weg von meinem Heimatverein. Dort lief es dann ganz gut. Nach zwei Jahren stand die Frage im Raum: Was mache ich jetzt? Ich habe dann mit Ismaning telefoniert. Das war zu der Zeit, als Ismaning ein Jahr zuvor im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund gespielt hatte. Ismaning ist immer noch ein richtig guter Amateurverein. Ich dachte mir: „Das probierst du jetzt mal.“ Und dann ging es so weiter. Ich merkte, dass ich in der Bezirksliga, Bezirksoberliga und dann auch in der Bayernliga mithalten konnte. Und wie es als Stürmer so ist, wenn man das Tor trifft, bekommt man Anrufe. Dann kam der Anruf aus Unterhaching. Als es dann Anfang 2003 losging, musste ich nicht lange überlegen. Aber sagen wir es so: Nach dem Wechsel nach Baldham dachte ich mir: „Okay, Bezirksliga, Bezirksoberliga, dann Bayernliga.“ Der Gedanke, Profi zu werden, war noch nicht so präsent, obwohl Fußball für mich immer einen großen Stellenwert hatte.
moneyschwabl: Dann kam ja der Anruf von Unterhaching, die damals in der zweiten Liga spielten. Mich würde interessieren, welche Pläne sie mit dir hatten, da du mit Copado, Vaccaro und so weiter bereits namhafte Konkurrenz auf deiner bevorzugten Position hattest. Wurde mit dir klar besprochen, wie man es heute so schön sagt, wie dein Weg aussehen soll, auch weil du im ersten Jahr (2003/04) viel unter Fredi Ruthe in der zweiten Mannschaft gespielt hast?
Robert Lechleiter: Genau, es war von vornherein klar, dass man mich nicht sofort in die zweite Liga holen würde, da ich aus der Bayernliga kam. Stattdessen wollte man mir die Chance geben, mich zu beweisen. Der Vorteil in Haching war, wie du bereits erwähnt hast, dass wir mit Fredi eine zweite Mannschaft hatten. Dort konnte man bei den Profis trainieren, Gas geben und schauen, ob man Einsätze bekommt. Wenn man am Wochenende nicht im Kader der ersten Mannschaft war, hatte man die Möglichkeit, in der Bayernliga Spielpraxis zu sammeln. Das war super, da ich die ganze Woche bei den Profis trainieren konnte und trotzdem meine Einsätze in der zweiten Mannschaft hatte. Deswegen ist eine zweite Mannschaft heutzutage immer noch wichtig, damit junge Spieler Spielpraxis sammeln können und nicht nur bei den Profis trainieren. Und dann, wie es oft so ist, wird man eingewechselt, absolviert sein erstes Zweitligaspiel, dann ein DFB-Pokalspiel, und so entwickelt sich die Sache.
moneyschwabl: Das DFB-Pokal-Spiel war noch früh in deiner Saison in Haching. Aber es dauerte trotzdem die ganze Hinrunde, bis du ab der Rückrunde einen festen Kaderplatz hattest, als Wolfgang Frank Trainer war. Und dann hast du am 30. Spieltag dein erstes Tor in Karlsruhe geschossen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Robert Lechleiter: Oh ja, das sind natürlich Spiele, die man nicht vergisst. Man arbeitet sich langsam heran, und dann kommt der Moment, in dem man eingewechselt wird. Dann muss man natürlich auch irgendwann treffen, sonst bringt es nichts. An das Tor in Karlsruhe erinnere ich mich gut, es war das 1:0 auswärts. Ja, das war natürlich ein cooler Moment.
moneyschwabl: Die Saison war nach dem Spiel in Karlsruhe praktisch zu Ende, dann kam Andi Brehme (zur Saison 2004/2005), und du bist kaum noch zum Einsatz gekommen. Du hast nur noch neun Spiele in der Folgesaison für die erste Mannschaft gemacht. Warum war diese Spielzeit so schwierig für dich, um deine Rolle zu finden?
Robert Lechleiter: Ich denke, die Qualität im Kader war damals schon sehr hoch, wie du bereits erwähnt hast. Und es ist nun mal so: Unter dem einen Trainer spielt man mehr, unter dem anderen weniger. Dazu kam, dass ich der Junge aus der Region war, und dann wurden neue Spieler geholt. Es ist klar, dass diese dann erst einmal im Vorteil waren. Das hat sich dann aber mit dem Trainerwechsel zu Harry und diesem ominösen Spiel gegen Greuther Fürth komplett gedreht.
moneyschwabl: Im April 2005 übernahm Harry Deutinger dann interimsweise, der dich schon länger kannte? Und dann beim Heimspiel gegen Fürth – ein Tor, drei Vorlagen. Ab diesem Zeitpunkt warst du gesetzt. Kann man sagen, dass du mit diesem Spiel deine Karriere richtig ins Rollen gebracht und im Profifußball Fuß gefasst hast? Wie hast du die Saison mit dem Klassenerhalt in Erinnerung? Du warst ja im besten Fußballeralter.
Robert Lechleiter: Ja, das war super. Man braucht Momentum und Glück. Harry kam zu mir und sagte: „Robert, du hast gut trainiert. Wir müssen gegen Fürth gewinnen, du spielst von Anfang an!“ Natürlich freut man sich, wenn man selten von Anfang an gespielt hat. Dass das Spiel dann so lief, mit einem Tor und drei Vorlagen, hat mir Standing für die nächsten Wochen gegeben. Ab diesem Moment habe ich jedes Spiel gemacht.
moneyschwabl: . In der darauffolgenden Saison kam es ja dann zum Abstieg. Aber zuvor gab es noch das legendäre 5:1 gegen 1860 im Derby. War das eines der schönsten Spiele deiner Karriere?
Robert Lechleiter: Wenn man an meine Zeit in Haching denkt, ist es interessant, dass mein vermeintlich bestes Jahr oder meine beste Saison ausgerechnet in dem Jahr war, in dem wir abgestiegen sind. So nah liegen Erfolg und Misserfolg manchmal beieinander. Aber natürlich bleiben viele Spiele in Erinnerung. Wir haben drei Derbys in Folge gewonnen, darunter ein 1:0 zu Hause gegen 1860, bei dem Kai Oswald das Tor schoss. Und natürlich das legendäre 4:1 in der Arena, das wohl kein Haching-Fan vergessen wird. Die Arena war ja fest in rotblauer Hand.
Und dann natürlich das Derby zu Hause. Die beiden Derbys in der Arena, das 4:1 und das 5:1 zu Hause, das ich glaube am 3. oder 4. Dezember stattfand, also etwa ein Jahr auseinander lagen, waren in meiner Zeit in Haching vom Erlebnis, vom Drumherum und von der Bedeutung her sicherlich die coolsten.
moneyschwabl: Am Ende dieser Saison kam dann der Feuerwehrmann Werner Lorant, der selbst viel qualmte, aber den Abstieg aus der zweiten Liga nicht mehr verhindern konnte. Wie bitter war es abzusteigen, und wie würdest du die Gründe dafür heute sehen, auch wenn du eine super Saison gespielt hast?
Robert Lechleiter: Ich glaube, dass es in der Zeit mit Haching in der zweiten Liga immer gegen den Abstieg ging. Es war jedes Jahr eine Herausforderung. In diesem besagten Jahr lief es für mich persönlich super, wir hatten eine überragende Mannschaft mit einem tollen Charakter und Zusammenhalt. Trotzdem hat es am Ende nicht gereicht. Es kamen unglückliche Umstände zusammen. Ich erinnere mich an Lattenschüsse von mir und Thomas Sobotzik in einem Spiel unter Werner Lorant, das wir hätten gewinnen müssen. Es gab bittere Niederlagen, wie das 0:1 in der Allianz Arena mit zwei fragwürdigen Abseitstoren – damals gab es noch keinen VAR. Vielleicht wäre ein Tor für uns gegeben worden. Am Ende hatten wir Pech und sind in Rostock abgestiegen, während Hansa aufgestiegen ist. Das war bitter, weil wir alles gegeben haben, aber es sollte nicht sein.
moneyschwabl: Du bist nach dem Abstieg trotzdem mit in die Regionalliga Süd gegangen. Gab es im Sommer Angebote für dich, zu wechseln?
Robert Lechleiter: Ja, es gab das ein oder andere Angebot. Ich habe lange überlegt, ob ich wechseln soll oder nicht. Letztendlich bin ich geblieben. Im Nachhinein war das Jahr mit Ralf (Hasenhüttl) etwas Besonderes. Das letzte Jahr in der Regionalliga, in dem wir uns für die dritte Liga qualifizieren konnten, war mit einer tollen Mannschaft ein tolles Jahr. Leider haben wir den direkten Wiederaufstieg nicht geschafft.
moneyschwabl: Was hältst du rückblickend von der Reform hin zur dritten Liga?
Robert Lechleiter: Da gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Das sieht man ja jetzt wieder an den Diskussionen um die Regionalliga, wo die Meister aufsteigen müssen, was ich voll unterstütze. Ich glaube, die Reform war damals gut, um gefühlt eine dritte Profiliga in Deutschland zu installieren. Allerdings hinkt die Liga finanziell hinter der zweiten Liga her. Viele Vereine haben Probleme, die Kosten zu decken, es ist wichtig, dass in dieser Liga viele junge Spieler spielen können.
moneyschwabl: Ulm und Elversberg sind tolle aktuelle Beispiele dafür, wie man mit einer stabilen Mannschaft durchmarschieren kann. Nun zurück zu Ralf Hasenhüttl, bei dem du auch während deines Trainerlehrgangs hospitiert hast. Wie unterschied sich seine Arbeit als Spieler für dich von der Arbeit anderer Trainer, die du zuvor hattest? Er war ja bereits ein sehr erfolgreicher Trainer in Unterhaching und gilt heute als Top-Trainer.
Robert Lechleiter: Als Spieler hat man es immer leicht, wenn man unter einem Trainer spielt. Interessanter finde ich es oft bei Trainern, unter denen man nicht spielt, weil man sich fragt, warum das so ist. Ralf war damals Co-Trainer unter Harry und Werner. Dann hat er in Unterhaching übernommen, was für ihn ein super Einstieg in seine Trainerkarriere war. Im Jahr darauf sind sie nur knapp am Aufstieg gescheitert. Ich erinnere mich an ein ominöses Spiel in Jena. Der Weg, den Ralf eingeschlagen hat, spricht für sich. Er ist ein Menschenfänger, der unglaublich gut mit jungen Spielern umgehen kann. Dazu kommt sein enormes Fachwissen. Das hat er bereits in Unterhaching bewiesen, ist mit Aalen aufgestiegen, und in Ingolstadt und Leipzig ging es genauso weiter bis zur Champions League. Auch seine Stationen in Southampton und jetzt Wolfsburg sprechen für ihn. Es ist toll, dass er aus Unterhaching kommt und das seine erste Trainerstation war. Er ist ein super Trainer.
moneyschwabl: Nach der Regionalligasaison bist du ans andere Ende der Republik nach Rostock in die zweite Liga gewechselt. Warum hast du dich für diesen Schritt entschieden, und wie schwer war es, dein gewohntes Umfeld zu verlassen?
Robert Lechleiter: Ich habe mich für diesen Schritt entschieden, weil Frank Pagelsdorf mich schon im Jahr zuvor holen wollte, als Hansa in die erste Liga aufgestiegen ist. Es wäre natürlich toll gewesen, die erste Bundesliga mitzunehmen. Das fehlt mir noch in meiner Karriere. Es war ungewohnt und weit weg, und sportlich lief es leider etwas turbulent. Die Mannschaft war abgestiegen, viele Verträge liefen weiter, und die Stimmung im Team war nicht immer optimal. Der Trainerwechsel von Pagelsdorf zu Dieter Eilts war für mich auch nicht ideal. Ich habe meinen Platz nicht richtig gefunden, obwohl ich ein paar Tore geschossen habe. Am Ende habe ich mich dann für das Angebot aus Aalen entschieden. Ich hatte zwar vorher einen Bundesliga-Vertrag in Rostock unterschrieben, aber ich habe mich dann für den Schritt in die dritte Liga entschieden, und es ist alles gut gekommen.
moneyschwabl: Du bist nach Aalen gegangen, wo du deine neue sportliche Heimat gefunden hast. Dort hattest du deinen ersten Kreuzbandriss, und es gab zwischenzeitlich sogar Viertklassigkeit. In der Saison 2011/2012 hast du dann eine grandiose Saison gespielt und ihr seid in die zweite Liga aufgestiegen. Was hat das Umfeld und der Verein Aalen damals alles richtig gemacht, oder was hat es für dich ausgemacht, dass ihr so erfolgreich wart?
Robert Lechleiter: Als ich nach Aalen kam, wollte der Verein unbedingt aufsteigen und hat viele Spieler geholt, darunter einige, die schon höherklassig gespielt hatten. In dem Jahr, als ich kam, sind wir abgestiegen, und ich habe mir den Kreuzbandriss zugezogen. Innerhalb eines Jahres hatte ich von einem Bundesliga-Vertrag in Rostock zu einem vertragslosen Zustand gewechselt, da mein Vertrag nicht für die Regionalliga galt. Ich habe mich entschieden zu warten. Wir sind nach Aalen gezogen, meine Frau hat unser erstes Kind bekommen, und wir haben gesagt, wir warten ab, was bis zum Winter passiert. Zum Glück konnte ich in dem halben Jahr Werbung für mich machen, sodass der Verein mich unbedingt behalten wollte. Dann kam Rainer Scharinger, mit dem wir sofort wieder aufgestiegen sind. Das war ein wichtiger Schritt für den Verein. Und dann kam Ralf Hasenhüttl, der die Mannschaft stabilisiert und das große Ziel erreicht hat: den Aufstieg in die zweite Liga.
moneyschwabl: Für dich war es wahrscheinlich trotz der turbulenten Zeit die richtige Entscheidung, zu bleiben. Du hast dann zwei Jahre als Stammspieler nochmal in der zweiten Liga gespielt. Mit 34 Jahren war dann verletzungsbedingt mehr oder weniger Schluss. Wie schwer war es, den Schlussstrich zu ziehen?
Robert Lechleiter: Man möchte nicht mit einer Verletzung aufhören. Für mich war es schwierig, weil ich mir den zweiten Kreuzbandriss im anderen Knie mit Knorpelschaden zugezogen hatte. Mit 34 Jahren wird es eng, so viele Spiele kommen nicht mehr, um richtig fit zu werden. Ich habe in der Reha alles versucht, musste aber einsehen, dass das Knie bis März nicht gut war. Dann haben wir gesagt, dass es so ist. So will man nicht aufhören, aber man muss schauen, was danach kommt. Irgendwann ist es sinnvoll, Servus zu sagen, auch wenn es schwerfällt. Der Schritt weg vom Fußball, den man nicht selbst in der Hand hat, ist nicht schön. Andererseits wurde mir die Entscheidung abgenommen. Ob ich mich dann noch einmal in den Mittelpunkt stellen muss, um Servus zu sagen, habe ich mich dagegen entschieden, und von daher war es okay.
moneyschwabl: Nach deiner aktiven Karriere bist du in die Heimat nach Aßling zurückgekehrt und wurdest Coach deines Heimatvereins, inklusive Aufstieg. War es geplant, mit der Familie zurückzugehen?
Robert Lechleiter: Wenn der Kreuzbandriss in Aalen nicht passiert wäre und ich ein, zwei Jahre länger gespielt hätte, weiß man nicht, was passiert wäre. In der Situation, als meine Tochter und dann mein Sohn geboren wurden, haben wir gesagt, wir gehen zurück. Bei uns ist es einfach richtig schön, das weißt du ja. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Das Engagement in Aßling ergab sich durch Freundschaften. Sie fragten mich sofort, als ich aufgehört hatte, ob ich Trainer werden möchte. Ich lehnte zunächst ab, aber rückblickend war es eine sehr gute Entscheidung. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wieder am Vereinsleben teilzunehmen, nicht nur den Fokus aufs Wochenende zu legen, sondern auch unter der Woche mit den Jungs Spaß zu haben.
moneyschwabl: Ich habe auch ein schönes Zitat von dir gesehen, dass du deine Trainerkarriere dort begonnen hast, wo du deine Spielerkarriere angefangen hast. Das finde ich eine runde Sache. Du bist dann aber für zwei Jahre als U19-Coach nach Unterhaching zurückgekehrt. Warum hast du dich für diesen Schritt entschieden? Ich gehe davon aus, dass es nicht gut bezahlt war. Du hast ja auch deine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht. War das davor oder danach?
Robert Lechleiter: Also, ich war mit der Ausbildung zum Immobilienkaufmann eigentlich fertig, als der Anruf aus Unterhaching kam. Sie fragten, ob wir uns mal zusammensetzen könnten, um Ideen für eine mögliche Trainertätigkeit zu besprechen. Von Unterhaching kommt man eben nicht los. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass sie an mich gedacht haben, und rückblickend war es genau das Richtige, weil ich wieder das machen konnte, was mir am meisten Spaß macht.
moneyschwabl: Warum ist die Arbeit im Jugendbereich für dich auch heute noch so spannend, als aktueller U19-Coach des SSV Ulm?
Robert Lechleiter: Ich durfte in der Regionalliga, der dritten Liga und der zweiten Liga spielen, wo viele der Spieler landen können, die in den NLZs ausgebildet werden. Abgesehen von den Top-Talenten, die es direkt in die Bundesliga schaffen, kann man den Jungs in der U19 einiges mitgeben, was sie im Herrenbereich erwartet. Das hat in Unterhaching Spaß gemacht, und in Ulm ist es genauso. Deswegen ist das ein Bereich, der mir zusagt.
moneyschwabl: Du warst im Anschluss auch Co-Trainer unter Ari van Lent und hast deinen zweiten Abstieg mit Unterhaching hautnah miterlebt. Ich habe die Saison für mich schon verarbeitet, aber warum wollte sich der Erfolg damals nicht einstellen, obwohl Unterhaching in fast allen Statistiken nicht wie ein Absteiger gespielt hat? Woran lag es, war es einfach Pech?
Robert Lechleiter: Mit Pech steigt man nicht ab, das wäre zu einfach. Wir kannten die Statistiken während der Saison und haben uns oft gefragt, warum wir es nicht schaffen, obwohl wir überall zwischen Platz 10 und 12 liegen. Wir haben Spiele zu einfach verloren, obwohl wir gut gestartet sind. Gegen Duisburg haben wir zu Hause 90 Minuten lang dominiert, aber trotzdem verloren. Dann kam ein Negativlauf, aus dem wir bis zum Winter nicht mehr herausgefunden haben. Dann kam Corona dazu. Rückblickend denkt man ab und zu, wie es gewesen wäre, wenn man etwas anders gemacht hätte. Unterhaching hat den Turnaround unter Sandro Wagner aber gut geschafft und ist wieder aufgestiegen. Jetzt ist die Situation wieder schwierig, aber sie haben am Wochenende ein Spiel gewonnen, und ich drücke die Daumen, dass sie eine Serie starten.
moneyschwabl: Du warst dann aber auch unter Sandro Wagner für die Neustrukturierung in der Regionalliga Bayern mitverantwortlich. Wie schwierig ist es für ein Trainerteam, die Aufstiegsambitionen, die in Haching wieder da waren, mit der finanziellen Realität zu vereinbaren?
Robert Lechleiter: Es gab einen riesigen Umbruch. Mit Sandro kamen viele neue Spieler, einige gingen. So etwas braucht Zeit. Das erste Jahr war nicht leicht, und es war nicht selbstverständlich, einfach durch die Regionalliga zu marschieren. Aber die Kaderstruktur, die in den beiden Jahren aufgebaut wurde, war gut, und die Aufstiegsmannschaft war richtig stark. Es wurde sehr gut gearbeitet, und der Aufstieg war verdient. Es kann auch mal zwei Jahre dauern, aber es hat ja dann wieder geklappt.
moneyschwabl: Dann warst du wieder ein halbes Jahr U19-Coach und danach hattest du quasi zwei Jahre Pause auf der Seitenlinie, bis du nach Ulm gekommen bist. Hast du in dieser Zeit die UEFA Pro Lizenz gemacht? Und wie sicher kann man sich eigentlich sein, einen Job im Fußball zu bekommen und zu behalten? Wie planst du das?
Robert Lechleiter: Mit der Pro Lizenz habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt. Wenn man sich dem Trainerberuf verschreibt, ist es wie im Handwerk, den Meister zu machen. Ich habe die Elite-Jugend-Lizenz und die A-Lizenz gemacht und mich für die Pro Lizenz beworben. Die Wahrscheinlichkeit, aufgenommen zu werden, war früher nicht sehr hoch. Als ich die Zusage vom DFB bekam, habe ich mich gefreut, weil es der nächste Karriereschritt ist. Mit diesem Schein hat man Möglichkeiten im Fußball. Ich bin im Moment tätig, und es macht mir Spaß. Ich habe einen Vertrag in Ulm bis 2026. Man kann im Fußball nicht planen, was nächste oder übernächste Saison ist. Es geht schnell in die eine Richtung, aber auch schnell in die andere. Ich bin da entspannt. Ich bin zunächst einen anderen Weg gegangen, dann kam der Fußball zurück, und jetzt habe ich die höchste Qualifikation.
moneyschwabl: Ich bin froh, dass du dem Fußball erhalten geblieben bist. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Du bist jetzt in Ulm tätig, einem Verein, der wie Haching eine Art Joint Venture mit dem FC Bayern eingeht. Wie viel merkst du von dieser Kooperation in deiner täglichen Arbeit, und worauf kann sich Haching diesbezüglich freuen oder einstellen, oder spielt das für dich keine Rolle?
Robert Lechleiter: Die Kooperation mit Bayern ist für jeden Verein interessant, weil es die Möglichkeit gibt, vom besten Verein Deutschlands und einem der besten Vereine Europas zu profitieren. Der Austausch ist da, und vielleicht kann man in der neuen Saison den ein oder anderen Spieler hin- und herschieben. Wenn wir Top-Talente haben, die für Bayern interessant sind, profitiert der untere Bereich davon. Es gibt einen guten Austausch, aber in meinem Bereich habe ich nicht täglich Berührungspunkte.
moneyschwabl: Okay, dann komme ich zu den letzten Fragen, dem Quickfire.
Wenn du im Fußball eine Regel ändern könntest, welche wäre das und warum?
Robert Lechleiter: Die Handspielregel, weil es Woche für Woche große Diskussionen gibt und man den Überblick verliert, ob es Handspiel ist oder nicht, siehe Deutschland bei der Europameisterschaft.
moneyschwabl: Wer war der beste Mitspieler in Unterhaching für dich?
Robert Lechleiter: Schwer, schwer, weil es richtig viele gute waren, richtig, richtig viele gute. Sehr schwer. Ich sag mal, auch wenn er schon drei Kreuzbandrisse gehabt hat, würde ich immer noch Roman Tyce sagen. Mit Roman hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil er immer den Blick nach Vorne hatte. Ich wusste, wenn ich losgelaufen bin, kam der Ball. Und das war natürlich für mich immer richtig gut, also da wäre ich beim Roman.
moneyschwabl: Unterhaching gilt ja immer als besonderer Club und wird von den Medien auch so umschrieben. Was macht diese Besonderheit von Haching eigentlich für dich aus?
Robert Lechleiter: Haching war vor und zu meiner Zeit besonders und ist es jetzt immer noch. Mein Sohn spielt ja auch dort. Es ist einfach dieses familiäre, dieses legere, dieses Flair, wenn du da hinkommst. Ob man dann mal im Biergarten sitzt, oder vor dem Spiel oder nach dem Spiel kannst du dich mit jedem unterhalten, jeder ist komplett offen. Das hat sich nicht geändert über die ganzen Jahre. Und ich hoffe, dass es auch in den nächsten Jahren so bleibt. Und ich sehe da keinen Grund, warum sich das ändern sollte.
moneyschwabl: Und die allerletzte Frage. Was war das schönste Tor, dass du jemals für Haching geschossen hast?
Robert Lechleiter: Boah, einmal in Augsburg, da ist mir mal einer aus über 30 Meter abgerutscht und dann würde ich mein Tor gegen die Löwen beim 5 zu 1 Sieg zu Hause nehmen. Das waren mit Sicherheit zwei von den Highlights.
moneyschwabl: Vielen Dank für das Interview!